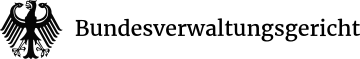Beschluss vom 18.05.2004 -
BVerwG 6 P 13.03ECLI:DE:BVerwG:2004:180504B6P13.03.0
Leitsätze:
1. Die Anfang 2001 getroffene Anordnung des Leiters eines Klinikums, durch welche den ärztlichen Mitarbeitern die Dokumentation und Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren nach den neuen Verschlüsselungskatalogen und -richtlinien auferlegt wurde, ist eine Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung im Sinne von § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Alternative 1 BaWüPersVG.
2. Das Mitbestimmungsrecht ist nicht mit Blick auf § 301 SGB V und Nr. 3 SR 2 c BAT aufgrund des Gesetzes- und Tarifvorrangs ausgeschlossen.
3. Die Mitbestimmung des Personalrats bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung ist nur eingeschränkt in der Weise verfassungsrechtlich zulässig, dass auf der letzten Stufe die Entscheidung der Einigungsstelle nur den Charakter einer Empfehlung an die zuständige Dienstbehörde hat.
4. Das Modell der eingeschränkten Mitbestimmung nach § 69 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BaWüPersVG ist auf die Mitbestimmung bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Alternative 1 BaWüPersVG entsprechend anzuwenden.
-
Rechtsquellen
BaWüPersVG § 69 Abs. 4, § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SR 2 c BAT -
Instanzenzug
VGH Mannheim - 11.03.2003 - AZ: VGH PL 15 S 643/02 -
VGH Baden-Württemberg - 09.07.2003 - AZ: VGH PL 15 S 643/02
-
Zitiervorschlag
BVerwG, Beschluss vom 18.05.2004 - 6 P 13.03 - [ECLI:DE:BVerwG:2004:180504B6P13.03.0]
Beschluss
BVerwG 6 P 13.03
- VGH Mannheim - 11.03.2003 - AZ: VGH PL 15 S 643/02 -
- VGH Baden-Württemberg - 09.07.2003 - AZ: VGH PL 15 S 643/02
In der Personalvertretungssache hat der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts auf die Anhörung vom 18. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. B a r d e n h e w e r und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. H a h n , B ü g e , D r. G r a u l i c h und V o r m e i e r beschlossen:
- Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg - Fachsenat für Personalvertretungssachen - vom 11. März 2003 wird aufgehoben.
- Die Beschwerde des Beteiligten gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart - Fachkammer für Personalvertretungssachen - vom 28. Januar 2002 wird zurückgewiesen.
- Der Gegenstandswert wird für das Rechtsbeschwerdeverfahren auf 4 000 € festgesetzt.
I
Zum 1. Januar 2001 setzte der Beteiligte die "Leitlinien zur Codierung von Diagnosen und Prozeduren im Klinikum Stuttgart" in Kraft. Darin ist festgelegt, dass der behandelnde Arzt, welcher die Leistung durchgeführt bzw. die Diagnose gestellt hat, die Diagnosen und Prozeduren jeweils zu dokumentieren und auf der Grundlage der Kataloge ICD-10-SGB-V und OPS-301 sowie der dazugehörenden Verschlüsselungsrichtlinien bzw. der demnächst veröffentlichten Deutschen Codierrichtlinien zu verschlüsseln hat.
Unter Hinweis auf vermehrte Beschwerden ärztlicher Mitarbeiter wegen erheblicher Zusatzbelastung machte der Antragsteller mit Schreiben vom 31. Januar 2001 geltend, die Einführung der neuen Anforderungen an die Dokumentation stelle eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme zur Steigerung der Arbeitsleistung dar, und forderte den Beteiligten zur umgehenden Einleitung eines Mitbestimmungsverfahrens auf. Dies lehnte der Beteiligte mit Schreiben vom 15. Mai 2001 im Wesentlichen mit der Begründung ab, die erweiterten Anforderungen an die - der ärztlichen Tätigkeit zuzuordnende - Dokumentation von Diagnosen und Prozeduren seien auf die ab dem Jahre 2001 von den Krankenhäusern umzusetzenden gesetzlichen Vorgaben zurückzuführen. Zugleich verwies er auf personelle Aufstockungen im Bereich des ärztlichen Dienstes sowie der Dokumentationsassistenten. Das daraufhin im personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren angerufene Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass dem Antragsteller bei der seit 1. Januar 2001 auferlegten Verpflichtung für alle Assistenzärztinnen und -ärzte im Bereich der Dienststelle des Beteiligten zur Verschlüsselung der Diagnosen nach ICD-10 und zusätzlich aller Prozeduren nach OPS-301 ein Mitbestimmungsrecht nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG zustehe.
Auf die Beschwerde des Beteiligten hat der Verwaltungsgerichtshof den erstinstanzlichen Beschluss geändert und den Antrag abgelehnt. In den Gründen hat er ausgeführt: Eine das geltend gemachte Mitbestimmungsrecht ausschließende tarifliche oder gesetzliche Regelung bestehe nicht. Weder § 301 SGB V noch § 17 b KHG regelten die Frage, wer für die vorgeschriebene Verschlüsselung innerhalb eines Krankenhauses zuständig sei. Die Verschlüsselung werde von der Dokumentationspflicht eines angestellten Arztes nicht erfasst. Das Verwaltungsgericht dürfte wohl zutreffend davon ausgegangen sein, dass die Übertragung der Verschlüsselungsaufgabe auf die ärztlichen Mitarbeiter eine Maßnahme zur Hebung von deren Arbeitsleistung darstelle. Der Beteiligte stelle letztlich nicht in Abrede, dass mit der abverlangten Verschlüsselung nach den neuen gesetzlichen Vorgaben die ärztlichen Mitarbeiter neben ihren unverändert bleibenden sonstigen Aufgaben zusätzliche Leistungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht erbringen müssten, die zu einem gewissen erhöhten Arbeitsaufwand auch in zeitlicher Hinsicht gegenüber dem früheren Zustand führten, auch wenn dessen konkreter Umfang streitig sei und in den einzelnen Krankenhäusern der Dienststelle einige wenige zusätzliche Stellen geschaffen und den neuen Gegebenheiten angepasste sächliche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt worden seien. Zwar dürfte mit dem Beteiligten davon auszugehen sein, dass ein erhöhter Arbeitsaufwand insbesondere durch die neuen Anforderungen an Art und Weise der zu erstellenden Dokumentationen hervorgerufen werde, während die Codierung nur noch die schlüsselgerechte Umsetzung der Dokumentationen erfordere. Gleichwohl sei davon auszugehen, dass die Verschlüsselung nach den neuen, insgesamt ganz erheblich vermehrten Schlüsseln in vielen Fällen selbst einen durchaus umfangreichen und komplizierten Arbeitsvorgang darstellen könne, der nicht nur ganz geringfügige und deshalb vernachlässigbare zusätzliche Anforderungen an den körperlichen Einsatz und insbesondere geistigen Aufwand der betroffenen Beschäftigten stelle. Die erhöhte Arbeitsbelastung dürfte für die betroffenen ärztlichen Mitarbeiter angesichts ihrer schon bisher erheblichen und keine Freiräume bietenden Arbeitsbelastungen unausweichlich sein. Letztlich bedürfe es aber keiner abschließenden Entscheidung, ob die Übertragung der gesetzlich angeordneten Verschlüsselung auf die ärztlichen Mitarbeiter eine Maßnahme im Sinne des § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG darstelle. Denn eine derartige Maßnahme verlasse den der Personalvertretung zugewiesenen innerdienstlichen Bereich. Die organisatorische Umsetzung der den Krankenhäusern zur Förderung ihrer Aufgaben im Rahmen der nach außen gerichteten Abrechnung mit den Krankenkassen als Leistungsvoraussetzung gesetzlich auferlegten Verschlüsselung der jeweiligen Diagnosen und Prozeduren nach den neuen Standards sei der Mitbestimmung entzogen. Denn ohne die Vornahme der gesetzlich vorgeschriebenen Verschlüsselung wäre dem Krankenhaus die Erfüllung seiner nach außen obliegenden Aufgaben nicht möglich.
Der Antragsteller trägt zur Begründung seiner Rechtsbeschwerde vor: Die vom Beteiligten gegenüber den ärztlichen Mitarbeitern ausgesprochene Verpflichtung sei eine innerdienstliche Maßnahme und damit der Mitbestimmung des Personalrats zugänglich. Der vom Verwaltungsgerichtshof angenommene Mitbestimmungstatbestand des § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG gehöre zu denjenigen Angelegenheiten, in welchen eine uneingeschränkte Mitbestimmung verfassungsrechtlich zulässig sei. Die streitige Maßnahme berühre nicht die Regierungsverantwortung. Selbst wenn der hier in Rede stehende Mitbestimmungstatbestand nach den Anforderungen des demokratischen Prinzips der eingeschränkten Mitbestimmung zugeordnet werden müsse, lasse sich durch analoge Anwendung der Vorschriften des baden-württembergischen Personalvertretungsgesetzes zur eingeschränkten Mitbestimmung ein verfassungskonformes Ergebnis erzielen.
Der Antragsteller beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerde des Beteiligten gegen den erstinstanzlichen Beschluss zurückzuweisen.
Der Beteiligte beantragt,
die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
Er trägt vor: Die Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren gehöre zum Berufsbild und damit zu den Dienstaufgaben des im Krankenhaus tätigen Arztes. Insofern gelte nichts anderes als für die ärztliche Dokumentation und das Schreiben von Arztbriefen. Nach den einschlägigen Sonderregelungen des Bundesangestelltentarifvertrages gehöre es zu den dem Arzt obliegenden Pflichten, ärztliche Bescheinigungen auszustellen. Hier gehe es um eine Bescheinigung des behandelnden Arztes gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse, indem der Arzt für den fraglichen Patienten die geforderten Diagnosen und Prozeduren bescheinige. Dies könne auch in verschlüsselter Form erfolgen. Die durch die gestiegenen Anforderungen an die Handhabung der Schlüssel hervorgerufene Mehrbelastung sei nicht auf eine Maßnahme des Dienststellenleiters zurückzuführen, sondern auf verbindliche externe Vorgaben. Die unstreitig gestiegenen Anforderungen an eine schlüsselgerechte Dokumentation dürfe nicht mit der Verschlüsselung selbst vermengt werden. Der gestiegene intellektuelle Aufwand durch die qualitative und quantitative Ausdehnung der Schlüssel entstehe weitgehend unabhängig von der Frage, wer die eigentliche Verschlüsselung vornehme. Gefordert sei hier nämlich die Kompatibilität der Dokumentation mit den Diagnosen- und Prozedurenschlüsseln. Die Verwendung des Computerprogramms "DIACOS" ermögliche nicht nur eine differenzierte, schlüsselkompatible medizinische Dokumentation, sondern sei auch in der Lage, sinnvolle Vorschläge für die Codierung von Diagnosen und Prozeduren zu liefern. Die Verschlüsselung könne einen durchaus umfangreichen und komplizierten Arbeitsvorgang dann darstellen, wenn sie nicht durch den behandelnden Arzt, sondern durch einen externen Dritten erfolge. Dies gelte umso mehr, wenn die diesem Dritten vorliegende ärztliche Dokumentation unzureichend oder unvollständig sei oder nicht den Schlüsselstrukturen entspreche. Diese geistig-intellektuellen Anstrengungen habe der Arzt jedoch schon in dem Arbeitsschritt Dokumentation geleistet. Der Verwaltungsgerichtshof habe keinerlei Feststellungen über das tatsächliche Maß der Belastungen getroffen und erst recht nicht dazu, welche Belastungen durch welche Arbeitsschritte konkret hervorgerufen würden. Dies werde ausdrücklich gerügt.
Sollten die Tatbestandsvoraussetzungen des § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG vorliegen, so wäre gleichwohl ein Mitbestimmungsrecht zu verneinen. Ein uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht sei im vorliegenden Fall verfassungsrechtlich unzulässig. Die analoge Anwendung der Vorschriften über die eingeschränkte Mitbestimmung scheide aus. Da der Landesgesetzgeber bei der Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 13. Dezember 1995 davon abgesehen habe, das bisherige Regelwerk an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen, müsse von einer vom Gesetzgeber gewollten Lücke des Landespersonalvertretungsgesetzes ausgegangen werden. Indem der Gesetzgeber die verfassungsrechtlich gebotene Anpassung hinausgeschoben habe, habe er zugleich seine Bereitschaft deutlich gemacht, in der Übergangszeit die Unwirksamkeit von Mitbestimmungstatbeständen im Anwendungsbereich des § 104 Satz 3 BPersVG hinzunehmen.
II
Die zulässige Rechtsbeschwerde des Antragstellers ist begründet. Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs beruht auf der unrichtigen Anwendung von Rechtsnormen (§ 86 Abs. 2 BaWüPersVG in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1996, GBl S. 205, zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 19. November 2002, GBl S. 439, i.V.m. § 93 Abs. 1 ArbGG). Er ist daher aufzuheben; da der Sachverhalt geklärt ist, entscheidet der Senat in der Sache selbst (§ 96 Abs. 1 Satz 2 ArbGG i.V.m. § 562 Abs. 1, § 563 Abs. 3 ZPO). Dies führt zur Zurückweisung der Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Beschluss. Die Anfang 2001 getroffene Anordnung des Beteiligten, durch welche er den ärztlichen Mitarbeitern die Dokumentation und Verschlüsselung nach Maßgabe der neuen erweiterten Verschlüsselungskataloge ICD-10 und OPS-301 sowie der jeweils gültigen Codierrichtlinien auferlegt hat, war nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Alternative 1 BaWüPersVG mitbestimmungspflichtig.
1. Das vom Antragsteller verfolgte Feststellungsbegehren ist zulässig (§ 256 Abs. 1 ZPO).
a) Es ist gemäß der bei Antragstellung gewählten und vom Verwaltungsgericht im stattgebenden Tenor aufgegriffenen Formulierung darauf gerichtet, dass dem Antragsteller "ein Mitbestimmungsrecht zusteht". Der Sache nach handelt es sich um einen konkreten Feststellungsantrag, da die streitige Anordnung, den ärztlichen Mitarbeitern die neuartigen Dokumentations- und Verschlüsselungspflichten aufzuerlegen, aufgehoben und das Mitbestimmungsverfahren nachgeholt werden kann. In einem derartigen Fall muss der Antrag darauf gerichtet sein, die Verletzung des Mitbestimmungsrechts festzustellen. Die hier gewählte Formulierung ist in der Weise zu verstehen, dass der Antragsteller die damalige Verletzung seines Mitbestimmungsrechts festgestellt wissen will mit der Folge, dass das Mitbestimmungsverfahren jetzt nachzuholen ist.
b) Der streitige Feststellungsantrag erstreckte sich von Anfang an zulässigerweise nicht nur auf die Verschlüsselung der Diagnosen und Prozeduren als solche, sondern auch auf die ihr jeweils vorausgehende verschlüsselungsgerechte Dokumentation. Wie die Beteiligten insoweit übereinstimmend während des gesamten Verfahrens - zuletzt auch in der Anhörung vor dem Senat - vorgetragen haben, haben die seit Januar 2001 zu beachtenden Verschlüsselungsvorschriften die Anforderungen an die Genauigkeit und den Differenzierungsgrad der Dokumentation deutlich verstärkt. Dokumentation und Verschlüsselung sind daher ein einheitlicher Lebensvorgang, der als ganzer der personalvertretungsrechtlichen Beurteilung zugeführt werden muss. Dass beides zusammengehört, ergaben schon Wortlaut und Kontext der "Leitlinien", die der Beteiligte Anfang 2001 in Kraft gesetzt hat. Dass die gestiegenen Anforderungen an die Dokumentation die eigentliche Mehrbelastung bedeuten, hat der Antragsteller bereits im Schreiben vom 31. Januar 2001 deutlich gemacht, mit welchem er erstmals sein Mitbestimmungsrecht geltend machte; dort hieß es: "Die Einführung der neuen Anforderungen an die Dokumentation stellt eine Maßnahme zur Steigerung der Arbeitsleistung gemäß LPVG § 79 Abs. 1 Nr. 5 dar."
2. Der Antrag ist begründet. Die Anfang 2001 getroffene Anordnung des Beteiligten zur Dokumentation und Verschlüsselung war mitbestimmungspflichtig. Das verletzte und nunmehr durch Nachholung des Mitbestimmungsverfahrens zu wahrende Mitbestimmungsrecht steht dem Antragsteller in seiner Eigenschaft als Gesamtpersonalrat zu (§ 9 Abs. 2 Sätze 1 bis 3, § 54 Abs. 1, § 85 Abs. 8 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 BaWüPersVG). Das Mitbestimmungsrecht ergibt sich aus § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Alternative 1 BaWüPersVG. Danach hat der Personalrat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestimmen über Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung.
a) Der Gesetzes- oder Tarifvorrang steht der Mitbestimmung des Antragstellers hier nicht entgegen.
Eine die Mitbestimmung des Personalrats ausschließende gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht dann, wenn darin ein Sachverhalt unmittelbar geregelt ist, es also zum Vollzug keines Ausführungsaktes bedarf. Eine solche Regelung besitzt Ausschließlichkeitscharakter, weil sie vollständig, umfassend und erschöpfend ist. Wenn jedoch aufgrund einer gesetzlichen oder tariflichen Regelung die Ausgestaltung der Einzelmaßnahmen dem Dienststellenleiter überlassen ist, unterliegt dessen Entscheidung - auch bei rein normvollziehenden Maßnahmen ohne Ermessensspielraum - der Richtigkeitskontrolle des Personalrats im Wege der Mitbestimmung (vgl. Beschluss vom 17. Juni 1992 - BVerwG 6 P 17.91 - BVerwGE 90, 228, 235; Beschluss vom 12. August 2002 - BVerwG 6 P 17.01 - Buchholz 251.7 § 72 NWPersVG Nr. 29 S. 35).
aa) Nach diesen Grundsätzen greift zunächst der Gesetzesvorrang hier nicht durch. Nach § 301 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3, 6 und 7 SGB V sind die nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser, zu denen auch das Klinikum Stuttgart zählt, bereits seit 1. Januar 2001 verpflichtet, den Krankenkassen bei Krankenhausbehandlungen die Einweisungsdiagnose, die Aufnahmediagnose, etwaige nachfolgende Diagnosen, Datum und Art der durchgeführten Operationen und sonstigen Prozeduren sowie die für die Krankenhausbehandlung maßgebliche Hauptdiagnose und die Nebendiagnosen zu übermitteln. Die Diagnosen und Prozeduren sind nach Maßgabe von § 301 Abs. 2 SGB V zu verschlüsseln. Diese gesetzlichen Bestimmungen besagen nichts darüber, welcher Beschäftigte im Krankenhaus die Verschlüsselung und die dem vorhergehende schlüsselgerechte Dokumentation vorzunehmen hat.
bb) Ebenso wenig steht der Tarifvorrang dem Mitbestimmungsrecht des Antragstellers entgegen. Die Mitbestimmung des Antragstellers ist nicht mit Rücksicht auf die Sonderregelungen des Bundesangestelltentarifvertrages für Ärzte in Krankenanstalten (SR 2 c BAT) ausgeschlossen. Nach Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 SR 2 c BAT gehört es zu den dem Arzt obliegenden ärztlichen Pflichten, ärztliche Bescheinigungen auszustellen. Eine ärztliche Bescheinigung ist das vom Arzt ausgefertigte Schriftstück, mit dem Vorgänge oder Zustände bestätigt werden, die in den Tätigkeits- und Kenntnisbereich des Arztes fallen. Da es sich um Bescheinigungen handelt, die von einem angestellten Krankenhausarzt auszustellen sind, muss der besondere Tätigkeitsbereich eines solchen Arztes zugrunde gelegt werden. Soweit die ärztliche Bescheinigung nicht lediglich tatsächliche Angaben enthält, beruht sie auf einer ärztlichen Diagnose, das heißt auf dem Erkennen und Feststellen eines medizinisch erheblichen Zustandes (vgl. BAG Urteil vom 10. Oktober 1984 - 5 AZR 302/82 - BAGE 47, 53, 58; Urteil vom 14. Mai 1987 - 6 AZR 555/85 - AP Nr. 46 zu § 611 BGB, Ärzte, Gehaltsansprüche).
Die im Krankenhaus gestellten Diagnosen sowie die dort vorgenommenen Prozeduren fallen in den Tätigkeits- und Kenntnisbereich des jeweils behandelnden Krankenhausarztes. Für die Verschlüsselung der Diagnosen und Prozeduren als solche gilt das nicht; diese kann auch von Dokumentationsassistenten vorgenommen werden. Denkbar erscheint, dass dies auch für die Transformation der ärztlichen Dokumentation in die schlüsselgerechte Dokumentation gilt. Hierzu hat der Beteiligte allerdings mit beachtlicher Argumentation vorgetragen, diese Transformation sei für den Dokumentationsassistenten kein Routinevorgang, sondern setze regelmäßig die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt voraus. Wenn dies zutrifft, erscheint die Konzentration von Dokumentation und anschließender Verschlüsselung beim behandelnden Arzt sinnvoll. Dieser Umstand könnte die Auslegung der genannten tarifvertraglichen Bestimmung beeinflussen. Wie die genannte Tarifnorm auszulegen ist, kann der Senat hier offen lassen.
Denn selbst wenn man sich mit dem Beteiligten auf den Standpunkt stellt, dass Dokumentation und Verschlüsselung auf die seit 1. Januar 2001 verlangte Weise zu den Dienstpflichten des Krankenhausarztes gehören, so ist dies nicht gleichbedeutend mit der Tarifautomatik, die das personalvertretungsrechtliche Mitbestimmungsrecht ausschließt. Vielmehr bleibt insofern eine Anordnung des Dienststellenleiters konstitutiv; dieser kann die Ärzte zur Verschlüsselung und schlüsselgerechten Dokumentation verpflichten, muss dies aber nicht tun. Er kann davon etwa zugunsten einer Übertragung dieser Aufgaben auf Dokumentationsassistenten absehen. Die durch § 301 SGB V geforderte Dokumentation und Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren findet im Grenzbereich zweier beruflicher Funktionen statt. Einerseits ist der behandelnde Krankenhausarzt aufgrund seines medizinischen Sachverstandes und seiner konkreten Erfahrungen mit dem jeweiligen Patienten für eine ordnungsgemäße Dokumentation unentbehrlich. Andererseits kann ihm dabei der Dokumentationsassistent in unterschiedlichem Maß behilflich sein. Verschiedene Kooperationsmodelle erscheinen denkbar, wie der Beteiligte mit seinen Schriftsätzen im Beschwerdeverfahren veranschaulicht hat. Die Frage war daher regelungsfähig und regelungsbedürftig. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn sich die vollständige Übertragung auf die behandelnden Krankenhausärzte am Ende als die sachgerechteste Lösung herausstellt. Die Entscheidung des Dienststellenleiters für die sinnvollste Lösung im Rahmen seiner tarifvertraglich konkretisierten Direktionsbefugnis ist nicht mit der mitbestimmungsausschließenden Tarifautomatik gleichzusetzen. Angesichts dessen verbietet sich die Annahme, die durch § 301 SGB V den Krankenhäusern auferlegte Dokumentations- und Verschlüsselungspflicht sei den Krankenhausärzten über Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 SR 2 c BAT als Bestandteil ihrer Dienstpflicht ipso iure zugewachsen. Vielmehr beließ das Tarifrecht dem Dienststellenleiter einen der Mitbestimmung des Personalrats zugänglichen Entscheidungsspielraum, zumal darin die für den Mitbestimmungstatbestand zentrale Frage nach der Zumutbarkeit einer Mehrbelastung der Ärzte infolge gestiegener Anforderungen an die Dokumentation und Verschlüsselung weder unmittelbar noch mittelbar beantwortet ist.
b) Die zum 1. Januar 2001 ergangene Anordnung des Beteiligten erfüllt den Maßnahmebegriff nach § 69 Abs. 1, § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG. Eine Maßnahme im Sinne des Personalvertretungsrechts muss auf eine Veränderung des bestehenden Zustandes abzielen. Nach Durchführung der Maßnahme müssen das Beschäftigungsverhältnis oder die Arbeitsbedingungen eine Änderung erfahren haben (vgl. Beschluss vom 28. März 2001 - BVerwG 6 P 4.00 - BVerwGE 114, 103, 105; Beschluss vom 14. Oktober 2002 - BVerwG 6 P 7.01 - Buchholz 250 § 75 BPersVG Nr. 104 S. 33). Durch die fragliche Anordnung haben die Arbeitsbedingungen der ärztlichen Mitarbeiter des Klinikums eine Änderung erfahren. Zwar gehörten Dokumentation und Verschlüsselung bereits vor dem 1. Januar 2001 zu ihrem Tätigkeitsbereich. Dieser Teil ihrer Tätigkeit wurde jedoch durch die zum 1. Januar 2001 in Kraft gesetzten neuartigen Anforderungen einer Änderung unterzogen. Die Krankenhausärzte hatten nunmehr die neuen Verschlüsselungskataloge sowie die dazu ergangenen Codierrichtlinien zu beachten.
c) Die streitige Anordnung des Beteiligten stellt eine Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung der ärztlichen Mitarbeiter dar.
aa) Der hier geltend gemachte Mitbestimmungstatbestand, für den sich die Entsprechung im Bereich der Bundesverwaltung in § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Alternative 1 BPersVG findet, hat den Senat vielfach beschäftigt. Seine dazu ergangene Rechtsprechung lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Unter den Mitbestimmungstatbestand "Hebung der Arbeitsleistung" fallen Maßnahmen, die darauf abzielen, die Effektivität der Arbeit in der vorgegebenen Zeit qualitativ oder quantitativ zu fördern, das heißt die Güte oder Menge der zu leistenden Arbeit zu steigern. Entscheidend ist, ob die beabsichtigte Maßnahme darauf angelegt ist, auf einem oder mehreren Arbeitsplätzen einen höheren mengenmäßigen Arbeitsertrag zu erzielen oder die Qualität des Arbeitsprodukts zu verbessern. Dabei ist als Hebung der Arbeitsleistung nicht die Steigerung der Menge oder Qualität des Arbeitsertrages anzusehen, sondern vielmehr die erhöhte Inanspruchnahme der betroffenen Beschäftigten, zu der solche Maßnahmen typischerweise führen. Diese kann in gesteigerten körperlichen Anforderungen oder in einer vermehrten geistig-psychischen Belastung bestehen. Der Zweck des Tatbestandes besteht darin, die betroffenen Beschäftigten vor einer unnötigen oder unzumutbaren Belastung zu bewahren (vgl. Beschluss vom 30. August 1985 - BVerwG 6 P 20.83 - BVerwGE 72, 94, 102 f.; Beschluss vom 23. Januar 1996 - BVerwG 6 P 54.93 - Buchholz 250 § 76 BPersVG Nr. 35 S. 9; Beschluss vom 13. Juni 1997 - BVerwG 6 P 1.95 - Buchholz 250 § 76 BPersVG Nr. 36 S. 13 f.; Beschluss vom 28. Dezember 1998 - BVerwG 6 P 1.97 - BVerwGE 108, 233, 236). Für den Mitbestimmungstatbestand "Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung" kommt es in der Regel auf die Zielgerichtetheit der Maßnahme an. Bezweckt der Arbeitgeber eine Hebung der Arbeitsleistung und soll dabei die Qualität der Arbeit unverändert bleiben, so ist es unerheblich, ob die Beschäftigten die möglicherweise nur in einem Teilbereich ihrer Arbeit erhöhte Inanspruchnahme durch eine Minderarbeit in einem anderen Bereich kompensieren können (Beschluss vom 28. Dezember 1998 a.a.O. S. 236 f.). Eine Maßnahme zielt nicht nur dann erklärtermaßen und unmittelbar auf eine Hebung der Arbeitsleistung ab, wenn der Dienstherr unzweideutig erklärt, dass er bei insgesamt gleich bleibender vorgeschriebener Wochenstundenzahl - beispielsweise - einen schnelleren Arbeitstakt oder einen höheren mengenmäßigen Ertrag erwarte. Vielmehr genügt es, wenn er dies sinngemäß unter Einbeziehung aller Umstände zum Ausdruck bringt (a.a.O. S. 238).
Nur ausnahmsweise erfasst die Mitbestimmung auch an sich nicht auf Hebung der Arbeitsleistung "abzielende" Maßnahmen, das heißt solche, bei denen eine derartige Zielrichtung mangels entsprechender Absichtserklärung nicht ohne weiteres feststellbar ist. Der Mitbestimmungstatbestand liegt auch dann vor, wenn unbeschadet sonstiger Absichten die Hebung zwangsläufig und für die Betroffenen unausweichlich (mittelbar) damit verbunden ist, das Arbeitsergebnis zu erhöhen. Dies ist anzunehmen, wenn Tätigkeiten in größerer Zahl bei unverminderter Güte in gleich bleibender, exakt festgelegter Zeit verrichtet werden müssen. Wesentlich für den Schluss von den objektiven Gegebenheiten auf den Zweck der Hebung ist die Unausweichlichkeit der mit der zwangsläufigen Beschleunigung oder Verminderung der zu verrichteten Tätigkeiten verbundenen erhöhten Arbeitsbelastung im Ganzen. Von einer solchen Unausweichlichkeit ist dann nicht auszugehen, wenn eine Kompensation an anderer Stelle etwa in der Weise in Betracht kommt, dass eine Verringerung anderer Tätigkeiten oder eine Verminderung der Arbeitsgüte anheim gestellt wird (vgl. Beschluss vom 17. Mai 1995 - BVerwG 6 P 47.93 - Buchholz 251.2 § 85 BlnPersVG Nr. 8 S. 9; Beschluss vom 28. Dezember 1998 a.a.O. S. 237). Dies kann - abhängig von den Gesamtumständen - auch stillschweigend geschehen, insbesondere dann, wenn den betroffenen Beschäftigten eine eigenverantwortliche Arbeitsgestaltung zugestanden ist (Beschluss vom 20. Juli 1995 - BVerwG 6 P 8.94 - Buchholz 250 § 76 BPersVG Nr. 34 S. 6). Eine Mitbestimmung scheidet in derartigen Fällen auch dann aus, wenn eine wesentliche Entlastung möglich ist und nur ihr Ausmaß sich nicht genau vorhersehen lässt. Eine zwangsläufige Mehrbelastung rückt den Zweck der Hebung der Arbeitsleistung erst dann in den Vordergrund, wenn entweder eine gleichzeitige Entlastung überhaupt nicht möglich ist oder aber die Summe aller gleichzeitig möglichen Entlastungen von vornherein und eindeutig hinter den Mehrbelastungen zurücktreten muss (vgl. Beschluss vom 20. Juli 1995 a.a.O. S. 5; Beschluss vom 13. Juni 1997 a.a.O. S. 15). Somit kommt es nur und ausschließlich in derartigen Ausnahmefällen darauf an, ob den Bediensteten eine Kompensation bei anderen Verrichtungen anheim gestellt ist (Beschluss vom 28. Dezember 1998 a.a.O. S. 237 f.).
bb) Die Senatsrechtsprechung ist in der Kommentarliteratur auf Kritik gestoßen (vgl. Ilbertz/Widmaier, Bundespersonalvertretungsgesetz, 10. Auflage 2004, § 76 Rn. 31; Altvater/Hamer/Ohnesorg/Peiseler, Bundespersonalvertretungsgesetz, 5. Aufl. 2004, § 76 Rn. 17 a). Diese Kritik geht im Wesentlichen dahin, dass es zu Rechtsunsicherheit führt, wenn für den Regelfall auf die Zielgerichtetheit der Maßnahme abgestellt und für den Ausnahmefall die Unausweichlichkeit der Mehrbelastung schon bei bloß anheim gestellter Kompensation verneint wird.
Der Kritik ist nicht zu folgen, soweit es um die Finalität der Maßnahme geht. Dieser in der Senatsrechtsprechung herausgehobene Gesichtspunkt trägt nämlich maßgeblich zur Berechenbarkeit des Mitbestimmungstatbestandes bei. Zielt die Maßnahme des Dienststellenleiters darauf ab, den Beschäftigten bei gleich bleibender Arbeitszeit mehr oder bessere Dienstleistungen abzuverlangen, so greift der Mitbestimmungstatbestand ein, ohne dass denkbaren oder anheim gestellten Entlastungsmöglichkeiten oder der Frage nach einer etwaigen Geringfügigkeit der Mehrbelastung nachzugehen ist. In den anderen Fällen, in denen die Maßnahme nicht erkennbar auf zusätzliche Belastung der Beschäftigten angelegt erscheint, kommt es nach dem Schutzzweck der Vorschrift auf die tatsächliche objektive Mehrbelastung an. Dass diese schon immer dann entfallen soll, wenn Entlastungsmöglichkeiten nur denkbar oder anheim gestellt sind, wird in der zitierten Kommentarliteratur mit erwägenswerter Argumentation beanstandet. Der vorliegende Fall bietet dem Senat indes zu einer näheren Überprüfung der gegen seine Rechtsprechung erhobenen Einwände keinen Anlass:
cc) Aufgrund der Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs und des unstreitigen Vortrags der Beteiligten steht fest, dass den ärztlichen Mitarbeitern des Klinikums zum 1. Januar 2001 eine Mehrbelastung auferlegt wurde, die durch Entlastungsmaßnahmen nicht ausgeglichen wurde.
(1) Der Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass bereits die neuartige Verschlüsselung als solche für die ärztlichen Mitarbeiter mit einer Mehrbelastung verbunden war, die durch zusätzliche Stellen und auch bei Verwendung des Computerprogramms "DIACOS" nicht vollständig ausgeglichen wurde. Dagegen spricht nicht die vorsichtige Wortwahl in demjenigen Teil der Gründe des angefochtenen Beschlusses, der sich mit dem Mitbestimmungstatbestand befasst (S. 17: "dürfte ferner wohl"; S. 19: "dürfte"). Damit wollte sich der Verwaltungsgerichtshof nur hinsichtlich der Subsumtion als solcher nicht festlegen. Die Verbindlichkeit seiner Aussagen zum Sachverhalt wird dadurch nicht berührt.
(2) Abgesehen davon ist unstreitig, dass die zum 1. Januar 2001 gestiegenen Anforderungen an Dokumentation und Verschlüsselung für die ärztlichen Mitarbeiter eine Mehrbelastung mit sich bringen. Dies wird insbesondere auch vom beteiligten Dienststellenleiter zugestanden. In seiner Rechtsbeschwerdeerwiderung stellt er unter Bezugnahme auf seinen Vortrag im Beschwerdeverfahren fest, dass die gesteigerte Verschlüsselungstiefe zwangsläufig und unausweichlich auch eine entsprechend gestaffelte, vertiefte Dokumentation der ärztlichen Tätigkeit erfordert (S. 4). Als Ursache dafür bezeichnet er die Einführung der erweiterten Schlüssel zum 1. Januar 2001 bzw. der Codierrichtlinien 2002 (S. 7). In seiner Beschwerdebegründung hatte der Beteiligte konstatiert, dass die unzweifelhaft entstehenden zusätzlichen Belastungen für die ärztlichen Mitarbeiter nicht durch die Verschlüsselung als solche hervorgerufen werden, sondern durch das Erfordernis der schlüsselkompatiblen Dokumentation der einzelnen Diagnosearten und Prozeduren (S. 9). Diese Sachdarstellung hat er in der Anhörung des Senats bestätigt und ergänzend angeführt, dass sich durch die neuartige Dokumentation und Verschlüsselung für die betroffenen ärztlichen Mitarbeiter der Zeitaufwand pro Patient um 5 bis 20 Minuten erhöht hat, und zwar bei einem Betreuungsaufwand von zwei bis drei Stunden je Patient. Zugleich hat er klargestellt, dass dieser zusätzliche Zeitaufwand sich auch bei Einsatz der genannten Computersoftware nicht nennenswert verringert, weil er ganz wesentlich durch die intellektuelle Bewältigung der nunmehr geforderten Dokumentationstiefe verursacht wird, und dass die personelle Aufstockung im Bereich des ärztlichen Dienstes und der Dokumentationsassistenten nicht speziell dem Ausgleich der hier in Rede stehenden dokumentationsbedingten Mehrbelastung diente, sondern als generelle personelle Entlastungsmaßnahme zu verstehen war.
(3) Auf der Grundlage dieses unstreitigen Sachverhalts und der zitierten Senatsrechtsprechung ergibt sich, dass die Verpflichtung der ärztlichen Mitarbeiter auf die Dokumentation und Verschlüsselung nach den neuen Katalogen und Richtlinien eine Maßnahme zur Hebung ihrer Arbeitsleistung darstellt. Zwar zielte die Anordnung des Beteiligten nicht darauf ab, den ärztlichen Mitarbeitern bei gleich bleibender Arbeitszeit eine größere Menge oder eine bessere Qualität an Dienstleistungen abzuverlangen. Sie diente vielmehr der Umsetzung der Vorgaben in § 301 SGB V und der dort in Bezug genommenen Verschlüsselungskataloge und -richtlinien. Sie stellte jedoch eine objektive Mehrbelastung dar, weil die neuartige Dokumentation und Verschlüsselung mit einem nennenswert größeren Zeitaufwand verbunden war, der durch personelle und technische Entlastungsmaßnahmen nicht aufgefangen wurde. Den ärztlichen Mitarbeitern war auch nicht ausdrücklich anheim gestellt, von Entlastungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Die Annahme, dass derartiges stillschweigend geschehen war, verbietet sich. Jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden, in welchem die medizinische Betreuung kranker Menschen im Vordergrund der den Beschäftigten obliegenden Dienstleistung steht, kann es nicht angehen, dass die Verantwortung für die Reduzierung der Dienstleistung auf die nachgeordneten Mitarbeiter abgeschoben wird. Diese Verantwortung muss der Dienststellenleiter gegenüber dem Bürger wie gegenüber der übergeordneten Dienststelle übernehmen, indem er die zu reduzierenden Teile der Dienstleistung konkret benennt.
(4) Die vom Beteiligten in diesem Zusammenhang in der Rechtsbeschwerdeerwiderung erhobene Gegenrüge, in welcher er dem Verwaltungsgerichtshof vorwirft, keinerlei Feststellungen getroffen zu haben über das tatsächliche Maß der Belastungen und dazu, welche Belastungen durch welche Arbeitsschritte konkret hervorgerufen würden, ist gegenstandslos. Sie war, wie der Beteiligte im Anhörungstermin des Senats bestätigt hat, im Kontext mit seinen Ausführungen zum Gesetzes- und Tarifvorrang allein für den Fall erhoben, dass sich die streitige Anordnung nur in ihrem die Verschlüsselung als solche betreffenden Teil als der Mitbestimmung zugänglich erweisen würde. Dies ist aber, wie die obigen Ausführungen zum Gesetzes- und Tarifvorrang ergeben, nicht der Fall; dass die neuartige Dokumentation und Verschlüsselung in ihrer Gesamtheit gegenüber dem vorherigen Zustand eine Mehrbelastung bedeutet, bestreitet der Beteiligte - wie dargelegt - nicht.
3. Die Mitbestimmung des Antragstellers nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Alternative 1 BaWüPersVG ist durch das demokratische Prinzip zwar eingeschränkt, aber nicht ausgeschlossen.
a) Die Mitbestimmung des Personalrats ist verfassungsrechtlich unter dem Gesichtspunkt des demokratischen Prinzips nur ausgeschlossen, wenn die Schutzzweckgrenze verletzt ist. Diese gebietet es, dass sich die Mitbestimmung des Personalrats nur auf innerdienstliche Maßnahmen erstreckt und nur so weit geht, als die spezifischen im Beschäftigungsverhältnis angelegten Interessen der Angehörigen der Dienststelle sie rechtfertigen. Innerdienstlich sind Entscheidungen im internen Bereich von Regierung und Verwaltung. Durch sie werden die Beschäftigten in ihren spezifischen Interessen als Beamte und Arbeitnehmer berührt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. Mai 1995 - 2 BvF 1/92 - BVerfGE 93, 37, 68, 70).
Die Anordnung des Beteiligten, durch welche er den ärztlichen Mitarbeitern des Klinikums ab 1. Januar 2001 aufgab, die Dokumentation und Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren auf der Grundlage der neuen Verschlüsselungskataloge und -richtlinien vorzunehmen, ist eine innerdienstliche Maßnahme. Sie erging im Rahmen des Dienstverhältnisses zwischen Dienstherrn und Beschäftigten, indem sie den Pflichtenkreis in einem Teilbereich der Tätigkeit neu bestimmte. Sie betrifft damit den internen Bereich des kommunalen Eigenbetriebs "Klinikum Stuttgart". Indem sie die schon bisher bestehende Verpflichtung zur Dokumentation und Verschlüsselung durch die Vorgabe neuer und höherer Anforderungen modifizierte, berührte sie die spezifischen Interessen der ärztlichen Mitarbeiter an der Begrenzung ihrer Arbeitsbelastung.
Die Anordnung des Beteiligten verliert ihren innerdienstlichen Charakter nicht dadurch, dass zwischen der Dokumentation und Verschlüsselung einerseits und der Erfüllung der Krankenhausaufgaben andererseits ein Zusammenhang besteht. Für innerdienstliche Maßnahmen ist auch sonst typisch, dass durch sie behördenintern die Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Amtsauftrages geschaffen werden. Dass die den ärztlichen Mitarbeitern obliegende Dokumentation und Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen und damit für die Erfüllung der Krankenhausaufgaben von erheblicher Bedeutung sind, wirft zwar die Frage nach der Verantwortungsgrenze und damit nach der Einschränkung der Mitbestimmung auf. Die Verantwortungsgrenze gebietet es jedoch nicht, Mitbestimmungstatbestände entgegen ihrem Wortlaut zwecks Herstellung eines verfassungskonformen Ergebnisses restriktiv zu interpretieren (vgl. Beschluss vom 19. Mai 2003 - BVerwG 6 P 16.02 - Buchholz 250 § 78 BPersVG Nr. 19 S. 4 f. m.w.N.).
b) Die Mitbestimmung des Antragstellers nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG ist durch die Verantwortungsgrenze eingeschränkt. Danach verlangt das Demokratieprinzip für die Ausübung von Staatsgewalt bei Entscheidungen von Bedeutung für die Erfüllung des Amtsauftrages, dass die Letztentscheidung eines dem Parlament verantwortlichen Verwaltungsträgers gesichert ist (BVerfG, Beschluss vom 24. Mai 1995 a.a.O. S. 70). Die zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich nicht darin, abstrakt diejenigen Angelegenheiten zu beschreiben, die einer Mitbestimmung des Personalrats in jeweils abgestufter Form zugänglich sind. Vielmehr wird in typisierender Form der vollständige Katalog der Mitbestimmungstatbestände nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz den drei Gruppen von Legitimationsniveaus zugeordnet. Für die "Gruppenzugehörigkeit" der einzelnen Maßnahme kommt es daher auf den personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungstatbestand an, nicht aber darauf, welche abstrakten Gruppenmerkmale die Einzelmaßnahme erfüllt (vgl. Beschluss vom 3. Dezember 2001 - BVerwG 6 P 12.00 - Buchholz 251.4 § 83 HmbPersVG Nr. 1 S. 8 f.).
Der Mitbestimmungstatbestand "Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung" nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG entspricht § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BPersVG. Sämtliche Mitbestimmungstatbestände in § 76 BPersVG hat das Bundesverfassungsgericht denjenigen innerdienstlichen Maßnahmen zugeordnet, die schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, unvermeidlich aber auch die Interessen der Beschäftigten berühren, und bei denen die Beteiligung der Personalvertretung höchstens in der Form der eingeschränkten Mitbestimmung in der Weise stattfinden darf, dass die Entscheidung der Einigungsstelle nur den Charakter einer Empfehlung an die zuständige Dienstbehörde hat ("Gruppe c"; vgl. Beschluss vom 24. Mai 1995 a.a.O. S. 72 f.). Diese Aussage des Bundesverfassungsgerichts ist unmissverständlich. Dementsprechend hat der Senat den landesrechtlichen, § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BPersVG entsprechenden Mitbestimmungstatbestand "Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen einen Beschäftigten" der "Gruppe c" zugerechnet (vgl. Beschluss vom 24. April 2002 - BVerwG 6 P 4.01 - Buchholz 251.4 § 86 HmbPersVG Nr. 9 S. 23).
Es ist sachlich gerechtfertigt, den Mitbestimmungstatbestand "Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung" dem höchsten Legitimationsniveau zuzuordnen. Die davon erfassten Maßnahmen der Dienststelle haben typischerweise Auswirkungen auf das Dienstleistungsniveau gegenüber dem Bürger. Sie sind geeignet, das Dienstleistungsangebot bei gleich bleibendem Personal zu verbessern oder bei reduzierter Personalstärke zu erhalten. Die durch eine verbindliche Entscheidung der Einigungsstelle bestätigte Zustimmungsverweigerung des Personalrats hat typischerweise Einfluss auf Art und Maß der weiteren Aufgabenbewältigung. Die Letztentscheidung muss daher der der Volksvertretung verantwortlichen Stelle vorbehalten bleiben.
Diese Einschätzung teilt der Bundesgesetzgeber. Er hat in § 69 Abs. 4 Satz 3 BPersVG sämtliche in § 76 BPersVG enthaltenen Mitbestimmungstatbestände denjenigen Angelegenheiten zugerechnet, in denen die Entscheidung der Einigungsstelle lediglich empfehlenden Charakter hat. Nach § 66 Abs. 1 Buchst. b des Personalvertretungsgesetzes - PersVG - vom 5. August 1955, BGBl I S. 477, hatte der Personalrat bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung lediglich ein Mitwirkungsrecht (§ 61 PersVG). Noch der von den damaligen Regierungsfraktionen vorgelegte Entwurf eines Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 13. Februar 1973 wollte daran nichts ändern (BTDrucks 7/176 S. 17). Zur Begründung des Mitwirkungskataloges hieß es generell: "Die Mitwirkung des Personalrats soll auf solche Angelegenheiten beschränkt bleiben, in denen die Verantwortung dem Dienststellenleiter auch nicht teilweise abgenommen werden kann." (a.a.O. S. 34 zu § 75). Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens ist das Beteiligungsrecht zwar auf das Niveau der eingeschränkten Mitbestimmung angehoben worden. Die Überzeugung, die Letztentscheidung in diesen Angelegenheiten bei der zuständigen Dienststelle zu belassen, wurde damit jedoch im Ergebnis nicht in Frage gestellt. Diese Rechtsüberzeugung wird von der großen Mehrheit der Bundesländer geteilt. Außer Baden-Württemberg räumen nur noch Bremen, Hamburg und das Saarland bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung ein uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht ein (vgl. Altvater u.a. a.a.O. Synopse 5 zu § 76 Abs. 2 BPersVG und § 75 Rn. 92).
c) Das Modell der eingeschränkten Mitbestimmung nach § 69 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BaWüPersVG erfasst nur Mitbestimmungstatbestände in §§ 75 und 79 Abs. 3 BaWüPersVG. Es ist jedoch auf den hier in Rede stehenden Mitbestimmungstatbestand nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG entsprechend anzuwenden.
aa) Durch die zitierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist eine planwidrige Lücke entstanden.
Nach § 64 Abs. 1 Buchst. b BaWüPersVG vom 30. Juni 1958, GVBl S. 175, stand dem Personalrat bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung lediglich ein Mitwirkungsrecht zu (vgl. § 59 BaWüPersVG 1958). Dieses Beteiligungsrecht wurde durch das Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 22. April 1968, GVBl S. 149, zu einem Mitbestimmungsrecht aufgestockt (§ 65 Abs. 1 Buchst. b BaWüPersVG 1958). Das Gesetz kannte damals nur Mitwirkung und uneingeschränkte Mitbestimmung. Der Schlussabstimmung im Landtag lag der Antrag des Verwaltungsausschusses zugrunde (4. Landtag von Baden-Württemberg, Beilage 5901). Die SPD-Fraktion hatte in ihrem Ergänzungsantrag vorgeschlagen, § 65 Abs. 1 Buchst. c des Gesetzes wie folgt zu fassen: "Durchführung der Berufs- aus- und -fortbildung" (a.a.O. Beilage 6013). Dem trat in der Plenardiskussion der CDU-Abgeordnete Schiess mit folgenden Worten entgegen: "Bei der Frage der Berufsfortbildung wird aber nicht nur in die sozialen Angelegenheiten, sondern außerordentlich stark auch in das Organisatorische der einzelnen Verwaltung eingegriffen. Eine solche Berufsfortbildung der Mitbestimmung zu unterstellen, erscheint uns erheblich zu weitgehend zu sein und einen zu starken Eingriff in das Gefüge der Verwaltung und ihre einzelnen Behörden zu bringen" (Landtag von Baden-Württemberg, Sitzungsprotokoll der 124. Sitzung vom 28. März 1968 S. 6951). Daraus lässt sich im Umkehrschluss herleiten, dass der Landesgesetzgeber seinerzeit keine Bedenken hatte, für die Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung ein uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht der Personalvertretung vorzusehen. Ersichtlich hat er sich damals noch - wie auch sonst Bund und Länder bei der Abfassung ihrer Personalvertretungsgesetze - am Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. April 1959 - 2 BvF 2/58 - (BVerfGE 9, 268, 282 ff.) orientiert. Dieses formulierte zwar bereits Einschränkungen für die Mitbestimmung der Personalräte in die Regierungsverantwortung berührenden Angelegenheiten, enthielt aber noch keine konkreten Hinweise auf verfassungsrechtliche Bedenken in Bezug auf den hier in Rede stehenden Mitbestimmungstatbestand (vgl. zur Bedeutung dieser Entscheidung bereits Beschluss vom 18. Juni 2002 - BVerwG 6 P 12.01 - Buchholz 251.7 § 72 NWPersVG Nr. 28 S. 32).
Indem das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 24. Mai 1995 für die Beteiligung des Personalrats bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung nur die eingeschränkte Mitbestimmung zugelassen hat, ist eine vom baden-württembergischen Landesgesetzgeber nicht beabsichtigte und damit planwidrige Lücke entstanden. Die bis dahin beim baden-württembergischen Landesgesetzgeber bestehende Rechtsüberzeugung, Maßnahmen der Dienststelle zur Hebung der Arbeitsleistung der Beschäftigten könnten ohne Verstoß gegen die Verfassung der vollen, auf der letzten Stufe mit einer verbindlichen Entscheidung einer paritätisch besetzten, weisungsunabhängigen Einigungsstelle verbundenen Mitbestimmung zugeführt werden, ist erschüttert worden.
bb) Der Ausfüllung dieser Lücke durch einen Analogieschluss steht nicht entgegen, dass der Landesgesetzgeber im Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 21. Dezember 1995, GVBl S. 879, davon abgesehen hat, das Gesetz in seiner bis dahin geltenden Fassung an die inzwischen bekannt gewordene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen. Eine richterliche Lückenfüllung im Wege der Analogie verbietet sich nicht schon deshalb, weil der Gesetzgeber nach dem erstmaligen Auftreten der Lücke an dem betreffenden Gesetz Änderungen vorgenommen hat. Gerichte haben vielfach einzelne Bestimmungen eines Gesetzes auf nicht erfasste Lebenssachverhalte entsprechend angewandt, ohne sich dadurch durch zwischenzeitliche Änderungen an anderen Vorschriften dieses Gesetzes gehindert zu sehen. Es gibt keine Automatik von Gesetzesänderung und Analogieverbot. Anders läge es nur, wenn sich aus den Gesetzesänderungen auf einen der richterlichen Lückenschließung entgegenstehenden Willen des Gesetzgebers schließen ließe. Das ist nicht der Fall. Wie sich aus den von den Beteiligten vorgelegten Gesetzesmaterialien ergibt, hat der baden-württembergische Landesgesetzgeber im Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz vom 21. Dezember 1995 nicht etwa zum Ausdruck gebracht, dass er die Zuordnung der Personalratsbeteiligung bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung zum Modell der uneingeschränkten Mitbestimmung weiterhin für verfassungsgemäß hält, etwa weil er in diesem Punkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht folgen will oder sie für auslegungsfähig hält. Vielmehr ist die Anpassung der von der Änderung nicht betroffenen Gesetzesbestimmungen deswegen unterblieben, weil die damaligen Koalitionsfraktionen CDU und SPD drei Monate vor Ende der Legislaturperiode die bereits abgestimmte Gesetzesänderung damit nicht mehr belasten wollten. Die Meinungen innerhalb der Koalition über die politischen Schlussfolgerungen aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 1995 gingen nämlich auseinander. Während der CDU vor allem daran gelegen war, das Gesetz an die einschränkenden Grundsätze der Entscheidung anzupassen, wollte die SPD daneben zur Kompensation die sich aus der Entscheidung auch ergebenden Spielräume für eine Ausweitung der Beteiligung nutzen (vgl. die Redebeiträge der Abgeordneten Oettinger und Göschel sowie des Innenministers Birzele in der Landtagssitzung vom 13. Dezember 1995, Landtag von Baden-Württemberg, Plenarprotokoll 11/77 S. 6487, 6489 und 6495). Da der Konflikt bis zu den Landtagswahlen im März 1996 nicht mehr lösbar erschien, wurde Einvernehmen darüber erzielt, die Behandlung der Thematik auf die nächste Legislaturperiode zu verschieben. Dementsprechend hat der Landtag in seiner Sitzung vom 13. Dezember 1995 beschlossen: "Der Landtag stellt fest, dass das bisher geltende Landespersonalvertretungsgesetz aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 1995 überprüft und in den Punkten, in denen sich ein Widerspruch zum Beschluss ergibt, geändert werden muss. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Prüfung baldmöglichst vorzunehmen und dem 12. Landtag entsprechende Vorschläge vorzulegen" (LTDrucks 11/6902 S. 31; Plenarprotokoll 11/77 S. 6499). In der folgenden Legislaturperiode ist es nur zur Erarbeitung eines Referentenentwurfs gekommen; das Vorhaben wurde jedoch bis auf weiteres zurückgestellt, um zunächst die Initiative des Bundes abzuwarten (vgl. das Schreiben des Innenministers des Landes Baden-Württemberg vom 25. November 1999 an den kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg).
Aus dem beschriebenen Verhalten des baden-württembergischen Landesgesetzgebers lässt sich ebenso wenig schließen, dass er bestimmte Teile des Landespersonalvertretungsgesetzes, darunter das hier in Rede stehende Mitbestimmungsrecht bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung, in der Übergangszeit bis zur Anpassung für verfassungswidrig und damit unanwendbar gehalten hat. Vielmehr erschöpft sich die zitierte Resolution in einem nicht weiter spezifizierten Prüfungsauftrag, der keine Hinweise auf das Ergebnis der Prüfung und die Art der Rechtsanwendung in der Übergangszeit liefert. Insofern erweist sich der Beschluss des Landtages in beiden Richtungen als indifferent: Weder erlaubt er den Schluss darauf, dass der Landtag an der zunächst ungeschmälerten Fortgeltung aller Mitbestimmungstatbestände festhalten wollte. Noch gibt er zu erkennen, dass er der Mitbestimmung des Personalrats in den überprüfungsbedürftigen Punkten bis zur Neuregelung eine Absage erteilen wollte. Letztere Annahme verbietet sich auch deshalb, weil seine im Änderungsgesetz vom 21. Dezember 1995 deutlich gewordene und umgesetzte Intention im Gegenteil auf den Ausbau der Rechtsstellung und Befugnisse des Personalrats gerichtet war (vgl. die zusammenfassende Darstellung im Redebeitrag des Innenministers Birzele a.a.O. S. 6494).
cc) Die analoge Anwendung des Modells der eingeschränkten Mitbestimmung in § 69 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BaWüPersVG auf den Mitbestimmungstatbestand nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG entspricht dem mutmaßlichen Willen des baden-württembergischen Landesgesetzgebers. Dieser hat den Personalvertretungen ein volles, uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht eingeräumt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die auf das in Baden-Württemberg vorgesehene Mitbestimmungsverfahren ohne Abstriche übertragbar ist, kommt aber allein ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht in der Weise in Betracht, dass die Entscheidung der Einigungsstelle nur den Charakter einer Empfehlung hat. Auf der Grundlage dieser Vorentscheidungen bleibt dem Landesgesetzgeber keine Entscheidungsalternative dazu, die Bezugnahme in § 69 Abs. 4 Satz 3 BaWüPersVG auf den Mitbestimmungstatbestand nach § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BaWüPersVG zu erweitern (vgl. zum Hamburgischen Personalvertretungsrecht: Beschluss vom 24. April 2002 - BVerwG 6 P 3.01 - BVerwGE 116, 216, 222 ff.; Beschluss vom 24. April 2002 - BVerwG 6 P 4.01 - a.a.O. S. 23 f.; zum nordrhein-westfälischen Personalvertretungsrecht: Beschluss vom 18. Juni 2002 - BVerwG 6 P 12.01 - a.a.O. S. 31 f.).
Die Erwägung des Beteiligten, beim mutmaßlichen Willen des Landesgesetzgebers an die frühere Senatsrechtsprechung zum Ausschluss der Mitbestimmung in aufgabenbezogenen Angelegenheiten anzuknüpfen (vgl. den von ihm zitierten Beschluss vom 23. Dezember 1982 - BVerwG 6 P 36.79 - Buchholz 238.31 § 79 BaWüPersVG Nr. 2 S. 3 f.), verbietet sich schon aus rechtssystematischen Gründen. Die hier anzustellenden Analogieüberlegungen beziehen sich nicht auf eine einzelne vom Personalrat wahrzunehmende Angelegenheit, sondern auf den gesamten abstrakten Mitbestimmungstatbestand. Dazu bietet die zitierte Senatsentscheidung keine Lösung. Abgesehen davon hat der Senat seine frühere Rechtsprechung mit Rücksicht auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgegeben, weil danach das demokratische Prinzip die Mitbestimmung des Personalrats bei innerdienstlichen Maßnahmen nicht ausschließt. Es wäre widersprüchlich, die durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entstandene Gesetzeslücke unter Rückgriff auf eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu schließen, die sich ihrerseits aufgrund eben dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als unzutreffend erwiesen hat.
dd) Die Senatsrechtsprechung zur analogen Anwendung des Modells der eingeschränkten Mitbestimmung zwecks Herstellung eines verfassungskonformen Ergebnisses ist in der Literatur auf Kritik gestoßen (vgl. Wahlers PersV 2003, 18; Blanke ZfPR 2003, 239). Im Kern geht der Vorwurf dahin, der Senat habe sich die Rolle des Ersatzgesetzgebers angemaßt. Diesen Vorwurf hat der Senat im Beschluss vom 24. April 2002 - BVerwG 6 P 3.01 - bereits antizipiert und ist ihm mit der Erwägung entgegengetreten, dass ein Eingriff in die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers nicht vorliegt, wenn die Art der Lückenfüllung im Landespersonalvertretungsgesetz bereits vorgezeichnet ist (a.a.O. S. 224). Er hat in diesem Zusammenhang auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 3. April 1990 - 1 BvR 1186/89 - (BVerfGE 82, 6,12) Bezug genommen. Danach können sowohl tatsächliche Veränderungen als auch die Fortentwicklung der Rechtslage eine bis dahin eindeutige und vollständige gesetzliche Regelung lückenhaft, ergänzungsbedürftig und zugleich ergänzungsfähig werden lassen. In einem solchen Fall sind die Gerichte befugt und verpflichtet zu prüfen, was unter den veränderten Umständen "Recht" im Sinne des Art. 20 Abs. 3 GG ist. Die Methode der Analogie stellt nicht die Äußerung unzulässiger richterlicher Eigenmacht dar, durch die der erkennbare Wille des Gesetzgebers beiseite geschoben und eine autark getroffene richterliche Abwägung der Interessen ersetzt wird. Vielmehr wird aus den Wertungen des Gesetzes entnommen, ob eine Lücke besteht und in welcher Weise sie geschlossen werden soll.
So liegt es auch im vorliegenden Fall. Maßgeblich für die richterliche Lückenschließung im Wege des Analogieschlusses ist nicht nur die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 1995, sondern auch die Entscheidung des baden-württembergischen Landesgesetzgebers, den Personalvertretungen bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung ein Höchstmaß an Mitbestimmung zukommen zu lassen. Auf der Grundlage dieser gesetzgeberischen Leitentscheidung ist die richterliche Lückenschließung - wie dargelegt - bereits eindeutig vorgezeichnet.
4. Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 1 BRAGO.